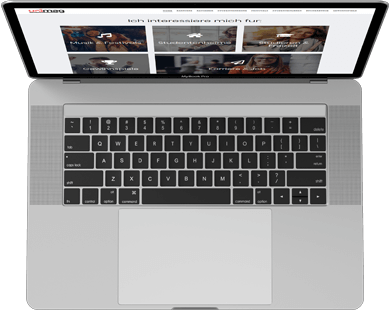UNIMAG hat den Wahlbriten Robert Rotifer zum Interview getroffen und mit ihm über Wien, die Universität und das leidige Studieren sowie natürlich allem voran über Musik und sein neues Album „The Cavalry Never Showed Up“ gesprochen.
Du bist Journalist, Musiker und Radiomoderator. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus? Gibt es den überhaupt?
Ich stehe um 6 Uhr 25 auf und mache meinem Sohn Tee und Toast, bevor er mit dem Rad ausfährt, um Zeitungen auszutragen. Nach und nach kommen alle runter zum Frühstück. Wenn alle in ihre Schulen gegangen sind, regen meine Frau und ich uns gemeinsam über die Nachrichten auf, dann geh ich in mein Büro und arbeite wie ein Irrer so wie jeder andere auch, weil wir alle Geld zum Leben brauchen. Zwischendurch halte ich es nicht mehr aus und nehm‘ mir eine Gitarre oder setz mich ans Klavier und schreibe einen Song, das ist ein großes Privileg. An anderen Tagen fahre ich nach London, schreibe im Zug dorthin und im Zug zurück und zwischendurch im Pub Artikel oder Texte, laufe durch die Stadt von Treffen zu Treffen, Interviews, Proben, Gigs. Wenn ich zurück nach Canterbury komme, wartet mein Fahrrad auf dem Bahnsteig. Grundsätzlich bin ich sehr erschöpft, aber wir alle laufen, so schnell wir können, nur um still zu stehen, da bin ich nicht der einzige. Beschwerden sollten wir also gemeinsam anbringen.
Wie war es für dich, nicht mehr als Kurator für das Popfest zu arbeiten?
Wunderbar. Patrick Pulsinger hat einen tollen Job gemacht, es gab keine panischen Anrufe, (fast) keine Probleme in letzter Sekunde, und ich konnte mich den Diskurs-Panels widmen, die mir jedes Jahr mehr Spaß machen. Allerdings war ich ziemlich fertig von der Autofahrt von England durch die Nacht und holte mir am ersten Abend einen Sommerschnupfen, den ich dann wochenlang nicht mehr los wurde. Ich halte die Hitze in Wien im Sommer nicht aus, um ehrlich zu sein. England hat viel besseres Wetter, nicht so extrem.
Erzähl uns doch etwas über dein neues Album „The Cavalry Never Showed Up“!
Ich war noch nie so zufrieden mit einer Platte. Ich hatte viel zu sagen, das sollte immer der Ausgangspunkt sein. Leute, die keine Textideen haben, verstehe ich genauso wenig wie Leute, die meinen, Pop hätte nichts Neues zu erzählen: Das Format ist schließlich nur die Hülle, und das beginnende 21. Jahrhundert scheint mir zur Füllung dieser Hülle reichlich Stoff zu liefern, von dem man vor 40 Jahren nicht einmal träumen konnte. Die alte Leier der endlos gedehnten, individuellen Befreiungsgeste ist nutzlos, ja zum Komplizen der entsolidarisierten Selbstausbeutungsgesellschaft geworden, und es ist eine großartige Herausforderung, eine neue Songtext-Sprache zu finden, die dieser Veränderung Rechnung trägt. Es gibt endlos viele Gedanken, zu denen noch keine Songs geschrieben wurden. Das Klammern an die mutmaßliche Innovation im Sound, die in Wahrheit ja immer bloß eine Kette ganz marginaler Veränderungen war, ist genauso eine Falle wie das Festhalten an ehernen Vintage-Gesetzen – eine Krücke für Leute, die nichts zu sagen haben, traurig und leer wie ein Apple-Store. Musikalisch gesehen wollte ich die Dynamik des Line-Ups mit Ian Button am Schlagzeug und Mike Stone am Bass einfangen, und das ist uns an zwei Tagen in den Soup Studios gelungen. Dann haben wir in meinem Büro/Studio an den Details gearbeitet. Einen Song hab ich mit den Bläsern von der Heilsarmee von Canterbury in einer Kirche in meiner Straße aufgenommen, mit meinem ersten selbst geschriebenen Arrangement, das war sehr befriedigend. Auf zwei Songs hab ich Wilko Johnsons Gitarrentechnik ausprobiert und dabei einen neuen Zugang zum Instrument gefunden. Im Moment überlege ich gerade, in welche von drei Richtungen ich mit der nächsten Platte gehen will.
Was inspiriert deine Musik? Welche Künstler beeindrucken dich? Und welchen Song der Musikgeschichte hättest du gerne geschrieben?
Ich habe das Privileg, alle zwei Wochen eine zweistündige Radiosendung mit neuer Musik füllen zu müssen. Ich weiß daher, wie viel großartige Musik gemacht wird, die eine Woche drauf wieder im Nirvana der Festplatte verschwinden wird. Das ist ein unausweichliches Problem, die Überproduktion erzeugt den Eindruck, es gäbe nichts Wesentliches Neues, dabei ist das Gegenteil der Fall, es gibt zuviel. Kiran Leonard fällt mir gerade ein. Dann war ich neulich beim alten Roy Harper in der Royal Festival Hall, der war sensationell gut. Zwei Tage nach unserem Konzert im Chelsea hab ich bei der Zugabe der Wave Pictures mitgespielt und mein Glück kaum fassen können. Ich glaube ernsthaft, dass das eine der besten Live-Bands ist, die es in diesem Format je gegeben hat. Nach diesem Interview werde ich mir die neue von Cate Le Bon anhören, davon erwarte ich mir Großes. Welchen Song hätte ich gerne geschrieben? Eine beliebte Frage, die ich nicht ganz verstehe. Wirklich gute Songs verselbständigen sich. Wenn ich also einen Song geschrieben habe, dann gehört er auf eine gute Art nicht mehr mir und ist nicht mehr vom Wunsch des Autors gehemmt, sein Publikum zu beeindrucken. Meine liebsten eigenen Songs spiele ich daher genauso wie ich ein Cover von jemandes anderen Song spiele. Aber wo du mich schon heute und in diesem Moment fragst: Gerade eben ist im Radio „Absolute Beginners“ von David Bowie gelaufen. Das ist ein Lehrstück von einem Lied. Wenn man das gehört hat, will man sofort auch was mit so einer fantastischen Akkordfolge schreiben.
Wie stehst du eigentlich zu Wien? Kommst du gerne in deine „Heimat“ zurück?
Ich verweise auf die zweite Strophe des Songs „Wear and Tear“, was die Nostalgie des Auswanderers und ihre zwangsläufige Enttäuschung angeht. Ansonsten genieße ich Wien, solange ich Zeit habe, dort einfach nur ziellos herumzugehen. Das ist leider nur mehr selten der Fall, wenn ich in der Stadt bin. Ich treffe gerne Freunde, mache aber immer den Fehler, mir zuviel auszumachen. Daher bin ich in Wien immer furchtbar gestresst und angespannt, da kann die Stadt aber nichts dafür. Die Stadt selbst ist immer noch toll, obwohl ihr Zentrum merklich an der seelischen Aushöhlung durch Kettenlädenmonotonie und Luxusmarkenschrott leidet.
Wie beurteilst du die österreichische Musikszene? Siehst du dich als ein Teil von ihr oder fühlst du dich mehr verbunden zum „typischen“ Brit Pop?
Ich weiß nicht, was typischer Britpop sein soll, das hab ich noch nie verstanden, kann meinen Standpunkt jetzt aber auch nicht näher erklären, weil ich dieses Interview nicht mit Bandnamen kontaminieren will, die darin nichts zu suchen haben. Ich habe in beiden Szenen ungefähr gleich viele Freunde, mit denen ich auch gerne Musik mache. Komischerweise gab’s da bisher wenig Überschneidungen, aber unser Gare du Nord-Label arbeitet daran, das zu ändern, und das macht großen Spaß. Neulich hatten wir bei einem Londoner Gig sowohl Bo Candy & His Broken Hearts als auch die Londoner Band Fever Dream mit dabei, das hat wunderbar geklappt.
Zu guter Letzt: Welche Frage habe ich dir nicht gestellt, die du aber gerne beantworten würdest?
Vielleicht, was ich selbst auf der Uni in Wien gemacht habe? Ich habe einiges studiert, aber nichts fertiggebracht. Dafür haben wir Ende der Achtziger bis Mitte der Neunziger auf der Uni viel Zeit mit Streiken zugebracht, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin nicht stolz auf meinen Studienabbruch, ich hatte Glück, dass man damals für Musikjournalismus noch bezahlt bekam. Aber ich bin manchmal etwas deprimiert über den Siegeszug des Karrierismus an den Universitäten, befeuert vom logischerweise unerfüllbaren Versprechen, dass jede und jeder es zu was bringen kann. Man sollte an diese falschen Verheißungen nicht glauben, sonst gibt man sich selbst die Schuld, wenn man scheitert. Der Wettbewerb ist nicht frei, das Spielfeld nicht eben, die Regeln nicht fair, und was auf der Uni passiert, wird den Rest des Lebens nicht bestimmen – egal, was sie einem erzählen.